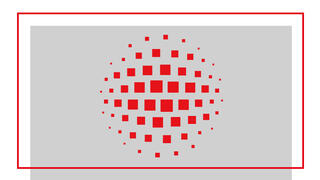Normalerweise ist Günter Althaus ein recht entspannter Typ, aber ein Thema regt den Chef des international tätigen Handelsverbunds ANWR Group regelmäßig auf: der Kult ums Duzen.
Das Verhalten vieler seiner Managerkollegen sei „geradezu anmaßend“, sagt Althaus: „Ich halte es schlicht nicht für zulässig, dass der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern vorschreibt, wie sie sich gegenseitig anreden.“ Er selbst duzt von etwa 600 Mitarbeitern in 14 europäischen Ländern allenfalls ein knappes Dutzend Kollegen. Aber vor allem deshalb, weil er sie schon lange kennt. Im Vorstand verständigen sich die Mitglieder erst nach vier Jahren aufs Du, sagt Althaus. Gegenüber der Belegschaft schaffe hingegen das Siezen eine professionelle Arbeitsebene. So sei sichergestellt, dass bestimmte Regeln im Umgang miteinander gewahrt bleiben. Althaus: „Negatives Feedback zum Beispiel wird dann nicht unnötig scharf und persönlich.“
Duz-Zwang am Arbeitsplatz schadet
Der Manager mag eine Ausnahme sein, aber er hat zahlreiche Wissenschaftler auf seiner Seite. Denn tatsächlich warnt eine Reihe von Forschern inzwischen sogar vor dem Zwang zum Du am Arbeitsplatz, und zwar aus mehreren Gründen: Die vertrauliche Anrede passt nicht zu jedem Unternehmen; sie liegt nicht jedem Angestellten; und sie erschwert das gegenseitige Miteinander – sowohl für den Chef als auch für dessen Mitarbeiter.
Denn so offensichtlich die Vorteile des Duzens sein mögen, so deutlich zeigen sich im Alltag die Tücken der verbalen Nähe. Und zwar nicht nur, weil diese Offenheit häufig nur vorgetäuscht ist, was Mitarbeiter wiederum frustrieren kann. Viele Führungskräfte reagieren ebenfalls verunsichert auf die sprachlich aufgehobenen Hierarchien.
Umgangsformen: Wer bietet wem das Du an?
Natürlich machen Knigge & Co. auch vor der Anrede nicht halt. So gibt es auch beim Siezen und Duzen klare Regeln, wer wem das du anbietet. Die Dame sagt zum Herren: „Wollen wir nicht Du sagen?“
Der Senior bietet dem Junior das Du an und nicht umgekehrt
Der Ranghöhere bestimmt die Anredeform. Also: Der Chef bietet dem Azubi das Du an.
Der Fluch der Lässigkeit
In anderen Ländern erlebt das Sie daher gerade eine Renaissance – ausgerechnet in Schweden. Die dortigen Weltkonzerne wie Ikea oder H&M schreiben ihren Mitarbeitern den zwanglosen Ton bereits seit Jahren vor, duzen alle Kunden und begeistern damit viele Touristen. Schweden duzen inzwischen sogar das Finanzamt. Vielleicht haben sie es mit der sprachlichen Nähe etwas übertrieben. Denn in Schweden lebt das „Ni“ wieder auf – eine Anrede, die früher der Adel nutzte. Vor allem jüngere Menschen benutzen es, beobachtete der nationale Sprachrat vor einigen Jahren.
In vielen deutschen Unternehmen hingegen geht es häufig ganz schön lässig zu. In einer Zeit, in der selbst Dax-CEOs wie Dieter Zetsche (Daimler) oder Oliver Bäte (Allianz) bei öffentlichen Auftritten Turnschuhe und Jeans tragen, verändert sich auch die Kommunikation. Die Vorstände des Hamburger Versandhändlers Otto boten im vergangenen Jahr der Belegschaft geschlossen das Du an. Johann Jungwirth, Digitalchef des Volkswagen-Konzerns, verkündete, er lasse sich am liebsten mit seinen Initialen „J. J.“ anreden.
Und Klaus Gehrig, Chef der Schwarz-Gruppe, zu der unter anderem Lidl gehört, erklärte per Mail, dass sich im Konzern künftig alle Mitarbeiter beim Vornamen anreden dürften: „Gruß, Klaus.“

Sollte das ein Angestellter lediglich als unverbindlichen Vorschlag verstanden haben, wurde Gehrig später noch mal deutlicher. Wer sich nicht duzt, isoliere sich: „Das sind nicht die Leute, die wir brauchen.“ Internationale Konzerne geben sich ebenfalls betont locker. Beim spanischen Mobilfunkanbieter Telefónica zum Beispiel duzen selbst die Auszubildenden ihren Chef. Inspiriert vom scheinbar familiären Geist der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley, ist die informelle Anrede heute weitverbreitet. In jedem dritten deutschen Unternehmen wird bereits quer durch alle Hierarchien geduzt, ergab vor einigen Monaten eine Studie der Unternehmensberatung Kienbaum und des Karriereportals Stepstone.
Das liegt zu einem guten Teil an der Gründerszene – und an Menschen wie Louis Pfitzner. Vor fünf Jahren gründete der heute 37-Jährige in Berlin zusammen mit zwei Geschäftspartnern die Onlineplattform Salonmeister, die heute unter dem Namen Treatwell Friseur-, Kosmetik- oder Massagetermine in mehr als 20.000 Salons europaweit vermittelt. Pfitzner ist als Geschäftsführer Chef von 60 Mitarbeitern. Wie in der Start-up-Szene üblich, duzt er sich mit allen. Mit Gesprächspartnern einigt er sich meist schon nach wenigen Sätzen darauf, dass man sich doch auch duzen könne.