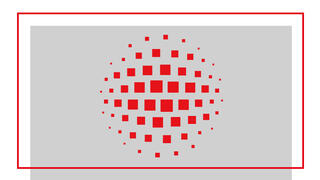Vielleicht war das iPhone das letzte große Statussymbol. Ein Demonstrationsobjekt des kollektiven Begehrens, des unbedingten Haben- und Zeigen-Wollens. Der Philosoph und Managerberater Jürgen Werner erinnert sich jedenfalls gut daran, welches Aufsehen man machen konnte, vor zehn Jahren, wenn man das am ersten Verkaufstag erworbene Apple-Produkt präsentierte. Gerade in Unternehmenskreisen: Man gehörte zur „Avantgarde“, durfte sich im Gefühl sonnen, „als Erster die Schwelle zu einer neuen Zeit“ überschritten zu haben. „Jeder wollte das Ding in die Hand nehmen“, sagt Werner, „jeder brauchte keine zwei Sekunden, um zu wissen: Das muss ich auch haben.“
Und heute? Ist es nur eine Frage der Zeit, wann das iPhone das Schicksal anderer Statusgüter ereilt. Das der Flachbildschirme etwa, die schon als vulgär gelten. Oder der PS-starken Imponierautos, auf die Jüngere nur noch mit Achselzucken reagieren. „Statussymbole“, so Jürgen Werner, „haben etwas Tragisches, manchmal auch Tragikomisches, weil sie überstrapaziert werden: Sie sollen von allen anerkannt werden und zugleich den Unterschied herausstreichen, das Individuelle betonen. Daran können sie heute nur scheitern.“ Soll das heißen, die Statussymbole sind tot? Ist ein Nachruf fällig? Keineswegs. Statussymbole, sagen Soziologen, wird es immer geben, solange der Wettbewerb um Anerkennung währt und wir uns gegenseitig beobachten und einsortieren.
Menschen sind geborene Selbstdarsteller, sagt Gerhard Schulze, der Autor der „Erlebnisgesellschaft“, sie machen das Leben zur Bühne, wollen zeigen, wer sie sind (oder gerne wären) – und mit wem sie lieber nichts zu tun haben möchten. Nicht die Statussymbole, so Schulze, seien verschwunden, „wohl aber ihre gesellschaftliche Reichweite“: Wir haben es „mit einer Partikularisierung der Symbolwelt zu tun“, mit einer Auffächerung in separate Milieus der Statusinszenierung: Bayreuth-Pilger und Regatta-Freunde, Hipster und Piercing-Fans kultivieren ihren speziellen Binnen-Code, bei dem es darauf ankommt, sich selbst zu beeindrucken.
Vor allem in den Traditionsmilieus lebt das alte Statusdenken fort, etwa in den Vorstandsetagen der Banken, wo man einander am Maßanzug erkennt (durchstochene Knopflöcher an den Jackettärmeln), auf Sylt, wo die Snob-Hamburgerin noch immer die dunkelgrüne Barbourjacke trägt (mit Logobrosche am Kordkragen links, damit jeder sieht, dass das Teil echt ist) – oder im „Closed shop“ der Megareichen, die ihre millionenschwere Kunstsammlung präsentieren als neoaristokratisches Superstatussymbol der Macht. In den breiten „Komfortzonen“ der Gesellschaft hingegen pflegt man das Understatement als diskretestes Distinktionsmerkmal. Oder man spielt mit den Statussymbolen, unterläuft sie „ironisch“, übertreibt sie, parodiert sie postmodern, wie es die Gebildeten unter ihren Verächtern tun.
Wenn es – wieder – eine tonangebende, stilprägende Schicht gibt im Umgang mit den „feinen Unterschieden“, dann ist es die neue akademische Mittelklasse, die mittlerweile das obere Drittel der Gesellschaft ausmacht. Sie definiert sich vor allem über ästhetische Codes: über Geschmack, Stilsicherheit und kultivierten Konsum. Es geht ihr nicht primär um die Dreieinigkeit von Haus, Auto und hohem Einkommen, sondern um Lebensqualität. Sie ist nicht bestrebt, Kaufkraft zu demonstrieren, sondern Kennerschaft zu beweisen.
Der an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder lehrende Kultursoziologe Andreas Reckwitz hat in seinem jüngst erschienenen Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“ deren Porträt gezeichnet, das Bild einer Klasse von begabten Nonkonformisten, die um Anderssein bemüht sind, um es mit anderen aus ihrer Peergroup zu teilen. Vor allem Design und Produktimage werden wichtig, wenn die Biografie zum Stilprojekt avanciert: Man sucht sein Heil in der Ausgestaltung seiner Existenz mit besonderen, unverwechselbaren Dingen und Erlebnissen. Weshalb man bei der Abendeinladung vom Besuch bei einem jungen, genialischen Moselwinzer schwärmt oder von der Vintage-Fotografie aus den Dreißigerjahren, die man in einer kleinen, feinen Berliner Galerie erworben hat.
Im „Modus der Singularisierung“, so Reckwitz, wird das Leben „nicht einfach gelebt“, nein, es wird komponiert und „kuratiert“: Das kreative Subjekt stellt seinen Konsum aus Versatzstücken virtuos zusammen, von der Garderobe bis zum nächsten Reiseziel. Man „kauft“ sich nicht „glücklich“, sondern wählt Dinge aus, die einen „kulturellen Mehrwert“ haben, gibt sich antikonventionell, sucht nach Konsum-Arrangements, die eine persönliche Handschrift verraten.