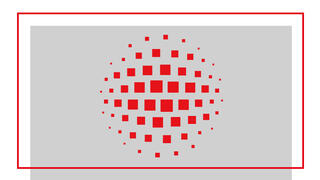Dortmund Farouk Alasas kennt nur ein paar deutsche Wörter, „Wohnung“ ist eines davon. Der 19-jährige Syrer zieht in ein paar Tagen in eine eigene Bleibe. „Viele Leute wollen keine Flüchtlinge in ihrem Haus“, erzählt er auf Englisch, „es war sehr schwierig.“
Bettina Bielefeld, die im Dortmunder „Projekt Ankommen“ auch Farouk betreut, berichtet ausführlicher: Sprachbarriere, kein eigenes Einkommen, Sorge der Vermieter um die Hausgemeinschaft, Vorurteile gegen Ausländer. „Da gibt es viele Ängste.“ Und: „Es gibt einfach zu wenig Wohnungen, auch für Deutsche.“
Dem Bericht der beiden lauscht aufmerksam Bundesbauministerin Barbara Hendricks, die in Dortmund auf Sommerreise ist. Erst vergangene Woche ging die SPD-Politikerin wohnungsbaumäßig in die Offensive und forderte, das Grundgesetz zu ändern, damit Bund und Länder wieder gemeinsam für den Bereich zuständig sind. Ob etwas draus wird, ist offen – die Union senkte erst einmal den Daumen. Geklappt hat jedenfalls, die Zuschüsse des Bundes an die Länder für sozialen Wohnungsbau und Stadtentwicklung aufzustocken.
In Deutschland müssen im Jahr rund 400.000 Wohnungen gebaut werden, da sind sich Politik, Baubranche und Mieterbund einig. Ohne Zuwanderung läge der Bedarf etwa bei 275.000, sagt Hendricks. Flüchtlinge brauchen eine eigene Bleibe spätestens, wenn sie anerkannt sind und Hartz IV bekommen. Wie viele es genau sind, dazu gibt es keine bundesweiten Zahlen. Klar ist: Dass Wohnungen fehlen, liegt nicht an ihnen. Aber sie konkurrieren mit deutschen Geringverdienern und Arbeitslosen, die günstig unterkommen müssen.
Wählerisch können sie daher nicht gerade sein. „Meistens sind die Wohnungen in schlechtem Zustand, direkt an der Hauptstraße oder mit sanitären Standards von 1950“, sagt Bernd Mesovic von Pro Asyl. Dazu komme die Lage. Flüchtlinge, die einen Job fänden, arbeiteten oft Nachtschichten, dann sei das Pendeln in Stadtteile weit außerhalb ein Problem. Sonderbauprogramme nur für die Geflüchteten lehnt die Hilfsorganisation aber ab - das würde nur Ressentiments schüren.
Stattdessen sollen alle Menschen in Deutschland profitieren, wenn in den Wohnungsbau Bewegung kommt. Im ersten Halbjahr 2016 wurden in Deutschland fast ein Drittel mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum, so viele wie seit 16 Jahren nicht. Besonders dringend fehlen Sozialwohnungen. Ihre Zahl ist zwischen 2006 und 2013 nach Angaben des Bauministeriums von knapp 2,1 Millionen auf rund 1,48 Millionen gesunken.
Um die Lage in den Ballungsräumen zu entspannen, dürfen Flüchtlinge sich ihren Wohnort künftig nicht mehr selbst aussuchen. Die Kommunen begrüßen das. Die Verteilung müsse aber auch von einem echten Integrationskonzept begleitet werden, mahnt Uwe Lübking vom Städte- und Gemeindebund. Und die Menschen sollten nur hingeschickt werden, wo es auch Arbeit gebe. „Natürlich haben wir in der Uckermark noch viel Wohnraum, aber der Bürgermeister sagt mir, er kann den Menschen keine Perspektive bieten.“ Trotzdem ist Lübking überzeugt: „Die besten Integrationschancen gibt es nicht immer in den Großstädten.“
Dorthin zieht es die meisten Flüchtlinge. Oft haben sie in einer Stadt schon Verwandte, Bekannte oder wenigstens Landsleute. Pro Asyl hält nichts davon, sie in kleinere Gemeinden zu schicken. Hendricks dagegen sagt: Auch dort gebe es Lehrstellen zu besetzen. Und es gebe nicht nur in Ostdeutschland Orte, die Zuzug bräuchten, um den Nachwuchs für Kindergärten und Schulen zu sichern. Anderswo sind sowohl Wohnungen als auch Jobs knapp: Dortmund hat weniger als zwei Prozent Leerstand und eine Arbeitslosenquote von fast zwölf Prozent.
Farouk, der vor gut acht Monaten mit seinem Onkel nach Deutschland gekommen ist, hat es erst mal geschafft. Er darf bleiben, hat einen Platz in einem Deutschkurs und will das in Aleppo begonnene Management-Studium fortsetzen. Sein Traum: ein eigenes Unternehmen. Bettina Bielefeld wünscht sich, dass es in mehr Fällen so gut läuft wie bei Farouk. Wenn die Flüchtlinge erst in den Wohnungen seien, gebe es selten Probleme. „Mülltrennung muss man besprechen“, erzählt sie. „Aber das Miteinander klappt eigentlich überraschend gut.“