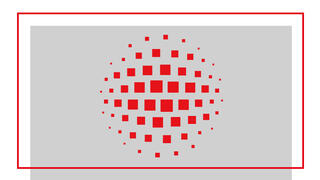Lange Zeit galt der Euro als schwache Krisenwährung. Auf dem Höhepunkt des europäischen Schuldendramas im Jahr 2012 verspotteten ihn manche Experten bereits als einen Fall für das wirtschaftshistorische Seminar. Alles tempi passati, so scheint es jedenfalls. Zwar sind die strukturellen Probleme der Peripherieländer in der Währungsunion noch immer nicht gelöst, die wackelnden Banken in Italien und die hohe Arbeitslosigkeit in Griechenland zeigen dies. Doch an den Finanzmärkten scheint das kaum mehr jemanden zu interessieren. Dort jubelt man jetzt über das „Comeback des Euro“ und sieht in ihm den „neuen Star am Devisenmarkt“. Denn seit Jahresbeginn kennt der Wechselkurs des Euro nur eine Richtung: Nach oben.
Gegenüber dem US-Dollar hat die Gemeinschaftswährung seit Januar um 14 Prozent an Wert gewonnen. Gegenüber dem britischen Pfund beträgt das Plus sieben, gegenüber dem Schweizer Franken 6,3 Prozent. Packt man die 18 wichtigsten Handelspartnerwährungen des Euro in einen Korb, so hat der Euro ihnen gegenüber um insgesamt sechs Prozent aufgewertet.
Die Renaissance der Gemeinschaftswährung hat Ökonomen und Devisenhändler überrascht. Sie hatten ihm zu Jahresbeginn – damals notierte er bei 1,04 Dollar – das baldige Abrutschen unter die Parität zum Dollar vorhergesagt. Dass es anders gekommen und der Euro heute an den Devisenmärkten schwer angesagt ist, hat politische und ökonomische Gründe.
Politisch betrachtet ist die Euro-Stärke zu einem erheblichen Teil auch eine Dollar- und Pfundschwäche. In den USA hat Präsident Donald Trump die Märkte mit seiner Wirtschaftspolitik enttäuscht. Die von ihm im Wahlkampf in Aussicht gestellten Steuersenkungen sind bisher ebenso ausgeblieben wie das avisierte milliardenschwere Infrastrukturpaket. Weil die Konjunktur anders als erwartet nicht heiß läuft, kann die US-Notenbank sich mit Zinserhöhungen mehr Zeit lassen als gedacht. Das schwächt den Dollar.







In Großbritannien lastet die Unsicherheit über den weiteren Fortgang der Brexit-Verhandlungen auf der Stimmung der Unternehmen. Die Konjunktur hat sich abgekühlt, Zinserhöhungen rücken in weite Ferne. Das drückt auf den Wechselkurs des Pfundes.
Dagegen hat sich in der Währungsunion aus Sicht der Finanzmärkte das politische Umfeld verbessert. Der befürchtete Wahlsieg der rechtsextremen Marine Le Pen in Frankreich ist ausgeblieben, auch in anderen Ländern haben die Populisten an Zustimmung verloren. Nach der Bundestagswahl, so hoffen die Akteure an den Devisenmärkten, werden sich Frankreich und Deutschland darauf einigen, noch mehr Risiken als bisher gemeinsam zu tragen. Der Ausbau der Eurozone zu einer Transferunion schreitet voran.
Dass die deutschen Steuerzahler dabei am Ende die Dummen sind, interessiert an den Finanzmärkten niemanden. Das Kalkül dort lautet vielmehr: Wenn Deutschland für alles und jeden haftet, wird der Euro überleben.